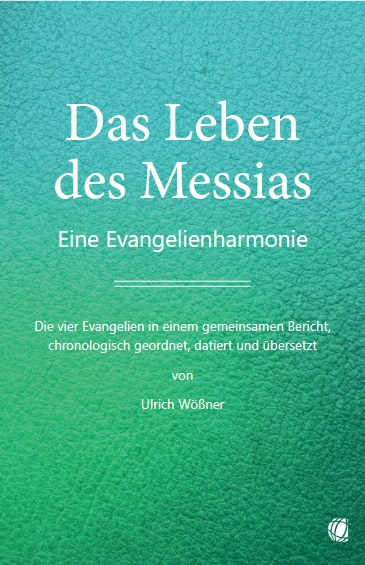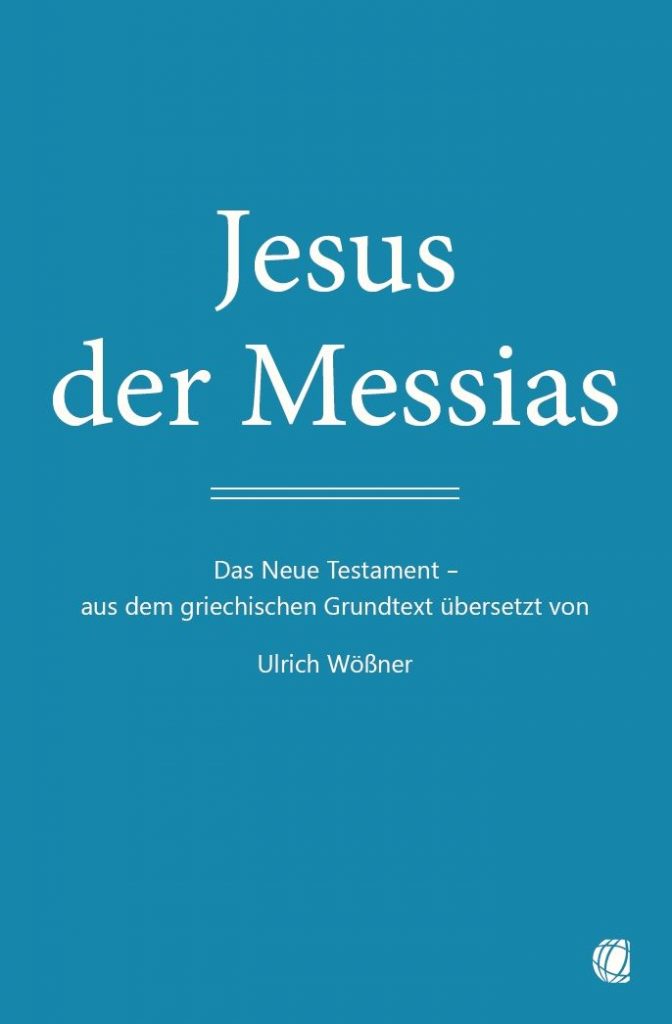Zur Frage „Wann ist Jesus geboren?“ wollen wir zunächst einen Blick auf ein paar Fakten zum Thema „Weihnachten“ werfen. Das fällt einem ja als erstes dazu ein. Das Wort „Weihnachten“ ist kein biblischer Begriff. Es kommt aus dem heidnisch-germanischen Vorfeld, in dem man die „geweihten Nächte“ feierte. Wenn mit der Wintersonnwende der Abwärtstrend der Sonne am Himmel und das Kürzerwerden der Tage gestoppt waren, war es natürlich ein Grund zum Feiern, dass sich der Trend jetzt umkehrte und die Tage ganz langsam wieder länger wurden.
Von diesem Ursprung her ist Weihnachten also nicht direkt ein heidnisches Fest, sondern ein Jahreszeitenfest. Dass es in Zeiten ohne elektrischen Strom ein Grund zum Feiern war und man es in der dunkelsten Zeit des Winters natürlich mit Feuer und Lichtern gefeiert hat, ist einleuchtend. Alle antiken Völker haben, soweit man weiß, die Wintersonnwende auf die eine oder andere Art gefeiert. Die ursprüngliche „Weihnachtsbotschaft“ heißt also: Wir haben den Wendepunkt überschritten, die Sonne steigt wieder höher, die Tage werden wieder länger und heller!
Dass Jesus nicht an Weihnachten geboren ist, ist den geschichtlich Gebildeten schon lange bekannt. Dass es irgendwann im Sommer gewesen sein muss, verraten uns die Hirten auf dem Feld bei Betlehem. Wann Hirten bei Betlehem auf dem Feld draußen waren, ist nämlich eine Frage der Jahreszeit. In Israel ist im Sommer Dürrezeit und im Winter Regenzeit. Die Zeit zum Säen ist im Herbst vor Beginn der Regenzeit. Dann kommt der „Frühregen“ und lässt das Getreide auf dem Feld keimen und wachsen. Im Frühjahr kommt dann der „Spätregen“, der das Getreide ausreifen lässt bis zur Ernte im April/Mai.
Die Hirten sind mit ihren Herden während der Regenzeit im Winterhalbjahr draußen in der Steppe. Dort wächst dann genug Futter, und sie halten sich mit ihren Schafen wohlweislich von den Getreidefeldern fern. Nach Beginn der Dürrezeit, wenn die Steppe abgeweidet ist und vertrocknet, kommen sie dann in das landwirtschaftlich genutzte Land. Hier dürfen die Tiere die abgeernteten Felder vollends kahlfressen und auch gleich düngen. Um Betlehem herum hat man viel Getreide angebaut. Das kann man schon im Buch Rut nachlesen. Und so kann die Zeit, in der dort Hirten mit ihren Herden auf dem Feld waren, nur im Sommer gewesen sein.
Jesus ist also irgendwann im Sommer geboren, aber wann genau? Lange dachte ich, man könne das eben nicht mehr wissen. Aber dann stieß ich in dem Buch von Bargil Pixner „Wege des Messias und Stätten der Urkirche“ auf die Information, dass es tatsächlich einen von den Anfängen her überlieferten Termin für die Geburt des Messias gibt, nämlich den 15. August.
Für die Qualität dieses Termins spricht die Tatsache, dass er auch dann erhalten blieb, als die römische Kirche (Papst) aus kirchenpolitischen Gründen die Feier der Geburt des Herrn 300 Jahre später auf die römische Sonnwendfeier am 25. Dezember verlegte. Man wollte so den Anhängern des Sonnenkultes eine „christliche“ Alternative bieten. Offensichtlich war der Termin 15. August aber so fest verankert, dass man ihn nicht einfach abschaffen konnte. Man musste ihn irgendwie umdeuten. Und so feiert man jetzt am 15. August nicht mehr, dass Maria da ihren Sohn Jesus geboren hat, sondern ihre angebliche „Himmelfahrt“ – ebenfalls eine Erfindung des römischen Stuhls.
(Das Schicksal einer Umdeutung hat übrigens auch den 6. Januar getroffen: Am Dreikönigstag bzw. Erscheinungsfest wurde ursprünglich der an diesem Tag geschehenen Taufe von Jesus im Jordan gedacht.)
Dass unsere Zeitrechnung nach „Christi Geburt“ nicht stimmt, ist den Informierten ebenfalls bekannt. Nur in welchem Jahr er wirklich geboren ist, ist umstritten. Im Jahr 28, als er mit seinem Werk anfing, war er nach Lukas 3,23 „etwa dreißig Jahre alt“. Das ist alles, was wir im Neuen Testament dazu erfahren. Jedenfalls hat zur Zeit seiner Geburt der König Herodes noch gelebt, der, wie man in allen Zeittabellen nachlesen kann, im Jahr 4 vor Christus starb. Dieses scheinbar sichere Datum wurde anhand einer Mondfinsternis festgelegt. Denn eine solche fand, wie Josephus berichtet, in dem Jahr statt, in dem Herodes starb.
Nun hat Werner Papke mit seinen astronomischen Kenntnissen in dem Buch „Das Zeichen des Messias“ recht einleuchtend Folgendes dargelegt: Die Mondfinsternis im Jahr 4 vor Chr. war nur eine Teilfinsternis. Im Jahr 2 v. Chr. gab es in Israel aber eine totale Mondfinsternis. Daher eignet sich dieses Jahr sehr viel besser als Todesjahr des Herodes. Und es passt insgesamt besser in die biblische Geschichte.
(Man hat hier auch ein Lehrbeispiel dafür, wie in der „Wissenschaft“ eine einmal aufgestellte falsche Hypothese fraglos immer wieder weitergegeben und abgedruckt wird, es steht ja in der Zeittafel …)
Der passendste Zeitpunkt für die Geburt von Jesus ist demnach der 15. August im Jahr 2 v. Chr.. Also war er im Jahr 28 tatsächlich „etwa dreißig Jahre“ alt. Bei seiner Taufe im Jordan am 6. Januar 28 war er dann 29 Jahre und knapp 5 Monate alt.