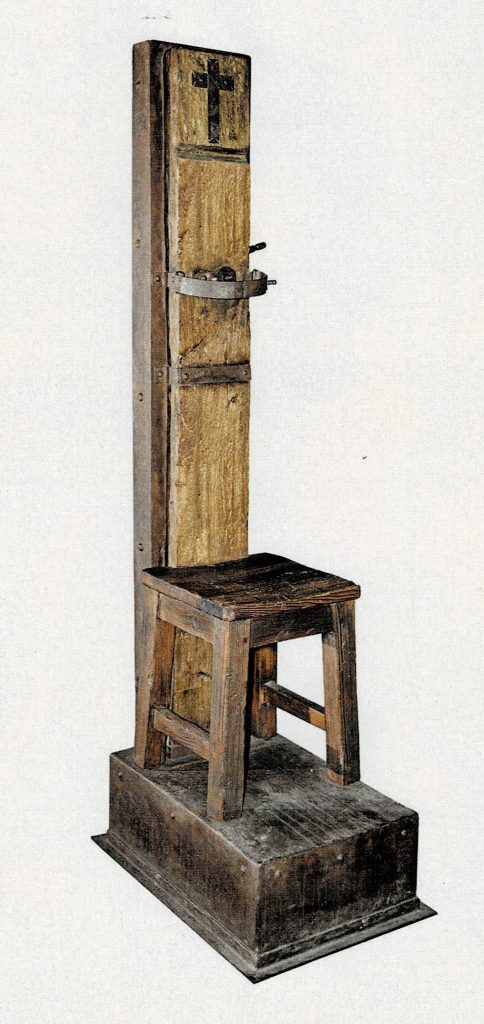Eine Parabel vom Schlüssel
Es war einmal ein Edler, dessen Freunde und Angehörige um ihre Freiheit gekommen und in fremdem Lande in eine harte Gefangenschaft geraten waren. Er konnte sie in solcher Not nicht wissen und beschloss, sie zu befreien.
Das Gefängnis war fest verwahrt und von inwendig verschlossen, und niemand hatte den Schlüssel.
Als der Edle sich ihn, nach vieler Zeit und Mühe, zu verschaffen gewusst hatte, band er dem Kerkermeister Hände und Füße und reichte den Gefangenen den Schlüssel durchs Gitter, dass sie aufschlössen und mit ihm heimkehrten. Die aber setzten sich hin, den Schlüssel zu besehen und darüber zu ratschlagen. Es ward ihnen gesagt: der Schlüssel sei zum Aufschließen, und die Zeit sei kurz. Sie aber blieben dabei, zu besehen und zu ratschlagen; und einige fingen an, an dem Schlüssel zu meistern und daran ab- und zuzutun.
Und als er nun nicht mehr passen wollte, waren sie verlegen und wussten nicht, wie sie ihm tun sollten. Die andern aber hatten’s ihren Spott und sagten: der Schlüssel sei kein Schlüssel, und man brauche auch keinen.
Eine Parabel vom Ackerbau
Es war eine Zeit, wo die Menschen sich mit dem, was die Natur brachte, behelfen und von Eicheln und anderer und harter und schlechter Kost leben mussten.
Da kam ein Mann mit Namen Osiris von ferne her und sprach zu ihnen: „Es gibt eine bessere Kost für den Menschen und eine Kunst, sie immer reichlich zu schaffen. Und ich komme, euch das Geheimnis zu lehren.“ Und er lehrete sie das Geheimnis und richtete einen Acker vor ihren Augen zu und sagte: „Seht, das müsst ihr tun! Und das Übrige tun die Einflüsse des Himmels!“ Die Saat ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und die Menschen waren des sehr verwundert und erfreuet und baueten den Acker fleißig und mit großem Nutzen.
In der Folge fanden einigen von ihnen den Bau zu simpel, und sie mochten die Beschwerlichkeiten der freien Luft und Jahreszeiten nicht ertragen. „Kommt“, sprachen sie, „lasst uns den Acker regelrecht und nach der Kunst mit Wand und Mauern einfassen und ein Gewölbe darüber machen und denn da drunter mit Anstand und mit aller Bequemlichkeit den Ackerbau treiben. Die Einflüsse des Himmels werden so nötig nicht sein, und überdies sieht sie kein Mensch.“
„Aber“, sagten andere, „Osiris ließ den Himmel offen und sagte: Das müsst ihr tun! Und das Übrige tun die Einflüsse des Himmels!“ – „Das tat er nur“, antworteten sie, „den Ackerbau in Gang zu bringen; auch kann man doch den Himmel an dem Gewölbe malen.“
Sie fassten darauf ihren Acker regelrecht und nach der Kunst mit Wand und Mauern ein, machten ein Gewölbe darüber und malten den Himmel daran. – Und die Saat wollte nicht wachsen! Und sie bauten und pflügeten und düngten und ackerten hin und her. – Und die Saat wollte nicht wachsen! Und sie ackerten hin und her.
Und viele von denen, die umher standen und ihnen zusahen, spotteten über sie! Und am Ende auch über den Osiris und sein Geheimnis.